Alternative Austragungsorte, andere Termine und eine modernisierte Infrastruktur wären mögliche Lösungswege. Vielleicht hilft eine solche Drucksituation sogar dabei, die marode Sportinfrastruktur aufzufrischen. Doch mit Manövern und Notlösungen ist es nicht getan – in Wirklichkeit geht es um die Substanz ganzer Sportarten und um die Frage, ob zukünftig überhaupt die Bedingungen noch gegeben sind, sie nicht nur in der Spitze, sondern auch in die Breite betreiben zu können.
340 Millionen Liter Wasser
Selbst Sportarten wie Golf, die besonders resilient wirken und dank der finanziellen Rückendeckung ihrer Zielgruppen besser gewappnet zu sein scheinen, werden massive Einschränkungen erleben und vielleicht sogar aus der analogen Welt verschwinden. Das wird weniger daran liegen, dass es Golferinnen und Golfern nicht mehr gefallen wird, sich bei 40 °C übers Fairway zu schleppen. Dürreperioden und daraus folgender Wassermangel machen den Betrieb von großflächigen Golfplätzen schon heute nicht nur moralisch, sondern auch technisch problematisch. In Kalifornien erstreckt sich ein durchschnittlicher 18-Loch-Golfplatz über etwa 45 bis 47 Hektar Land und verbraucht vorsichtig geschätzt um die 340 Millionen Liter Wasser pro Jahr – also in etwa die Menge, die man benötigt, um 136 olympische Schwimmbecken zu füllen.
Weil die fast 1.000 Golfplätze etwa neun Prozent des gesamten Wasserbedarfs Kaliforniens beanspruchen, hat die Regierung Vorgaben formuliert, die von Betreibern einen sparsameren Umgang mit dieser kostbaren Ressource fordern, und deren Strenge davon abhängt, wie drängend der lokale Wassermangel ist. 2022 mussten betroffene Betreiber in einem bestimmten Zeitfenster 15 Prozent ihres Wasserbedarfs einsparen. Obwohl die Vorgaben in Anbetracht der Dürreproblematik noch äußerst milde ausfallen (ein Schelm, wer gute Lobbyarbeit vermutet), haben sie dennoch dazu geführt, dass viele Golfplätze endlich Maßnahmen umsetzen, die den exzessiven Wasserbedarf spürbar einschränken: Im Rahmen ihrer reaktiven Strategie reduzieren sie „durstige“ Rasenflächen und greifen auf resistente, an Trockenheit gewöhnte Pflanzen zurück.
Einige Golfplätze investieren in drahtlose Bodensonden für Echtzeit-Feuchtigkeitsdaten zur präziseren Bewässerung oder installieren eigene Kläranlagen für die Wiederverwendung von Abwasser. Es ist dennoch absehbar, dass sich die Lage weiter verschärfen wird. Auch dank der 1.600 Privatjets, die im Rahmen der Masters-Woche auf dem kleinen Flughafen in Augusta landeten und geschätzt über 4.000 Tonnen CO2 ausgestoßen haben dürften.
Nicht allen im Golfsport scheint der Ernst der Lage also bewusst zu sein. Denn sämtlichen neuen Technologien zum Trotz wird der Anstieg der Durchschnittstemperatur den Wasserbedarf weiter steigen lassen – insbesondere für kritische Landwirtschaft, Kühlsysteme und andere unverzichtbare Bedürfnisse. Die Verfügbarkeit von Regen- oder Quellwasser nimmt hingegen bereits jetzt rapide ab. Daher wird sich der Golfsport noch weiter einschränken müssen – im Übrigen auch deshalb, weil die Öffentlichkeit keine Sportart tolerieren wird, die von teuren, energiehungrigen und oft toxischen Entsalzungsanlagen abhängig ist und die kostbare Ressource Wasser für einen etwas grüneren Rasen verschwendet. Gelingt es uns nicht, den Klimawandel einzuschränken, werden wir spektakuläre Puts schon bald nur noch in virtuellen Welten erleben können. Gelegen dürfte dann übrigens die TLG kommen, eine 3-gegen-3-Hallen-Golf-Liga, mitbegründet von Tiger Woods und Rory McIlroy. Im Kontext der globalen Klimakrise wirken die Bilder eines einzigen verkürzten Lochs in einer von Neonlicht getränkten Arena eher dystopisch als innovativ.
Stärkere Stürme, rauere See
Oft sind Veränderungen nicht mit bloßem Auge sichtbar, in ihrer Kraft aber enorm – etwa im Segelsport, insbesondere bei Wettbewerben wie dem Ocean Race, das gleich durch mehrere Weltmeere führt. Veränderungen in Windmustern und Meeresströmungen sorgen für unvorhersehbare Bedingungen, was die Navigation und Rennstrategie erschwert. Der Bedarf an fortschrittlicher Technologie für Wettervorhersage und Navigation wächst somit stetig, ebenso die Notwendigkeit, das Design von Segelbooten anzupassen. Zudem ergeben sich neue Sicherheitsherausforderungen, auch durch stärkere Stürme und rauere See. Langfristig wird dies dazu führen, dass traditionelle Segelrouten und die Regeln von Segelwettbewerben geändert werden müssen.
Natürlich wird auch Elektromobilität eine immer wichtigere Rolle im Wassersport spielen. 2024 startete die E1 Series, eine Rennserie für elektrisch betriebene Speedboote. Als Teamchefs sind dabei Sportgrößen beteiligt wie Tom Brady, Rafael Nadal oder Didier Drogba sowie verschiedene weitere Promis aus Kunst und Kultur. Der offizielle Bolide Racebird schießt mit knapp 100 km/h über die Küstengewässer von Venedig, Lagos, Rotterdam oder Monaco. Die Veranstalter wollen angeblich ein besonderes Augenmerk auf Wasserschutz und fossil-freie Mobilität richten. Ob eine internationale Rennserie dazu das richtige Mittel ist, bleibt fraglich. Solange immer größere Kreuzfahrtschiffe in See stechen dürfen, ausgerüstet mit haushohen Verbrennermotoren, wird sich der Wandel hin zu nachhaltigerer Schifffahrt vermutlich sowieso in Grenzen halten.
Nicht überraschend leidet der Wintersport unter den steigenden Temperaturen am stärksten. Eine Studie historischer Klimadaten der University of Waterloo in Kanada hat analysiert, wie sich künftige Szenarien für den Klimawandel in den Jahren 2050 und 2080 auf die 21 Städte auswirken, die bisher Gastgeber Olympischer Winterspiele waren. Darin wurde festgestellt, dass 2080 – falls die Treibhausgasemissionen nicht reduziert werden – mit dem japanischen Sapporo nur noch eine einzige Olympiastadt übrig bliebe, die zuverlässig Winterspiele ausrichten könnte. Werden die Emissionsziele des Pariser Klimaabkommens erreicht, erhöht sich die Zahl der Austragungsorte auf acht: Vancouver, Calgary, Salt Lake City, Lake Placid, Lillehammer, Oslo, Sapporo und Nagano. Sechs Austragungsorte – Squaw Valley, Garmisch-Partenkirchen, Chamonix, Turin, Sotschi und Pyeongchang – würden hingegen nach wie vor als unzuverlässig gelten. Besonders erschreckend: Die durchschnittliche Tagestemperatur im Februar ist in den bisherigen Austragungsorten bereits überdurchschnittlich stark angestiegen. Bei den Spielen in den 1920er- bis 1950er-Jahren lag sie noch bei 0,4 °C, in den 1960er- bis 1990er-Jahren waren es bereits 3,1 °C und bei den Spielen im 21. Jahrhundert ganze 6,3 °C.
Kann der Sommer den Winter retten?
Auch ohne alle Studien und Statistiken sind die Auswirkungen des Klimawandels auf den Wintersport unübersehbar. Wir alle kennen die befremdlichen Bilder frühlingshaft grüner Hänge, neben den Skiliften dünne Zungen Kunstschnee, auf ihnen eine Handvoll übriggebliebener Ski-Enthusiasten. Beim Anblick solcher Szenerien stellt sich die Frage, ob ein derart krampfhaftes Festhalten an einer vergangenen Wintersportgeschichte noch irgendeinen Sinn ergibt – einen wirtschaftlichen jedenfalls oft nicht mehr. Zwar ist die Ski-Industrie allein in der Alpenregion immer noch stolze 30 Milliarden Euro schwer – doch schmelzen sie dahin wie der Schnee, auf dem sie verdient werden.
Setzt sich der Trend fort, werden bei einer absehbaren Erderwärmung von 2 °C 53 Prozent bei 4 °C sogar 98 Prozent der 2.234 europäischen Ressorts ohne künstliche Beschneiung schließen müssen. Im französischen Ski-Ressort La Sambuy etwa – nicht weit entfernt gelegen vom höchsten Berg Europas, dem Mont Blanc – lag im Jahre 2022 gerade einmal vier Wochen lang Schnee, und dazu noch nur wenig davon. Kurz darauf fiel die Entscheidung, die Lifte abzubauen und sich nunmehr ausschließlich auf die Sommersaison zu konzentrieren. Allein in Frankreich wurden seit 2001 knapp 25 Skilifte demontiert, weitere 106 sind schlichtweg außer Betrieb.
In den USA hat der rasante Schneeschwund zur Ausprägung eines neuen Geschäftsmodells geführt. Über 75 % die Skifahrer in Arealen der Ressortgruppe Vail sollen bereits den so genannten „Epic Pass“ nutzen: Ein Jahresabo, das über 1.000 US-Dollar kostet und es erlaubt in jedem der 42 Skiressorts des Unternehmens so viel Ski zu fahren, wie man möchte. Nicht immer werden Nutzerinnen und Nutzer mit diesem Pass Geld sparen. Dafür haben sie aber die Möglichkeit, flexibel auf gute oder schlechte Schneebedingungen zu reagieren und laufen weniger Gefahr, einen Winterurlaub zu buchen, der am Ende wortwörtlich ins Wasser fällt. Ähnliche Angebote dürften zeitnah auch in Europa und anderen betroffenen Gebieten entstehen, wo sich insbesondere in Wintermonaten neue Netzwerke aus einst konkurrierenden, nun solidarisierenden Skiarealen bilden werden, um das jeweilige Risiko eine Saisonausfalls zu reduzieren.
Da hilft auch kein Kunstschnee
Nun könnte man denken, dass zumindest der Profisport noch auf ausreichend sichere Areale zugreifen kann. Aber mitnichten: Besonders sichtbar wurde das in der Ski-Weltcup-Saison 2023/2024; wegen ungünstiger Wetterbedingungen wie Regen, Wind, Schneemangel und schlechten Pistenverhältnisse mussten 20 von 90 Skirennen abgesagt werden – darunter der Damen-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen und der Herren-Weltcup in Chamonix. Im eigentlich tiefsten Winter lag in diesen traditionellen Skiorten nicht nur zu wenig Schnee, auch die Lufttemperaturen waren ganztägig zu hoch, um Schneekanonen sinnvoll einsetzen zu können.
Schneekanonen sind im Übrigen ein sehr gutes Beispiel für den nicht seltenen Konflikt zwischen proaktiven und reaktiven Strategien: Einerseits müssten ohne ihren Einsatz schon heute Ski-Areale reihenweise schließen, doch verbrauchen sie andererseits enorme Mengen an Wasser und Energie. Oft müssen für ihren Betrieb Speicherseen in Reichweite der Pisten angelegt werden. Für die künstliche Beschneiung wird pro Jahr und Hektar Pistenfläche etwa eine Million Liter Wasser verbraucht. In den Alpen führen auch deshalb einige Flüsse schon bis zu 70 Prozent weniger Wasser als vor der Einführung der Schneekanonen.
Hinzu kommen die Energiekosten: Für die Beschneiung eines Hektars Piste werden jährlich mindestens 15.000 Kilowattstunden Strom benötigt. Ist das Skigebiet beispielsweise 3.000 Hektar groß, wären das etwa 45 Millionen Kilowattstunden – genug, um 6.000 Klassenzimmer zu beheizen. Selbst bei 100 Prozent Ökostrom verursacht die künstliche Beschneiung eines solchen Skigebiets demnach etwa 450 Tonnen CO2, also jenes Treibhausgases, das für das Wegbleiben echten Schnees in erster Reihe verantwortlich ist. Ein Teufelskreis.
Verschiedene Unternehmen reagieren auf dieses Problem und suchen nach nachhaltigeren Alternativen. Das österreichische Startup Lumiosys hat die Software Schneeprophet vorgestellt, die Beschneiungsvorhersagen simuliert und so Skigebieten hilft, bis zu 40 Prozent Energie und Wasser zu sparen. Forscher vom Schweizer Lawinenforschungsinstitut haben hingegen eine Schneekanonen-Alternative entwickelt, die ohne Strom funktioniert. Die Schneilanze braucht keinen Propeller und keinen Kompressor, um Schnee zu streuen. Stattdessen lässt sie ihn von einer Höhe von etwa fünf bis zehn Metern herunterrieseln. Damit die Schneilanze aber funktioniert, benötigt sie neben niedrigen Temperaturen auch einen Wasserdruck von wenigstens 15 bar und damit Speicherseen, die mindestens 150 Meter höher liegen als das Skigebiet. Alles Mangelware.
Doch damit nicht genug: Der wachsende Einsatz von Schneekanonen geht Hand in Hand mit einem steilen Anstieg an Verletzungen um bis zu 20 Prozent. Denn Kunstschnee wird durch kleinere Wassertröpfchen gebildet, die schnell gefrieren und so eine feinkörnigere Struktur bilden als Naturschnee. Dadurch ist er dichter, härter und gefährlicher. Zu den häufigeren und schlimmeren Verletzungen trägt auch bei, dass Kunstschnee meist auf Pisten eingesetzt wird, die sowieso schon in suboptimalem Zustand sind – mit engerer Streckenführung, dünner Schneeschicht, versetzt von Steinen und Holzstämmen.
Der Untergang lässt auf sich warten
Bekanntlich macht Not erfinderisch – auch in Sportverbänden. Zumindest wenn es die Natur ihrer jeweiligen Sportart zulässt. Sandro Pertile, Renndirektor für Skispringen beim Ski-Weltverband FIS, schlug unlängst vor, etwa im Maracana-Stadion in Brasilien auf Matten zu springen. Was wahnwitzig klingt, funktioniert bereits ähnlich in anderen Sportarten. Außerdem werde in Sommermonaten schon längst auf „Trockenem“ gesprungen. Die Idee sei, mobile Skisprungschanzen zu entwickeln, die auch in Ländern ohne traditionelle Wintersportinfrastruktur aufgebaut werden können. Es habe schon mehrere Besprechungen mit Interessenten für den Bau einer derart modularen Stahlkonstruktion gegeben. Pertiles Skisprung-Wanderzirkus zielt darauf ab, Skispringen zu einem weltweiten Sport zu machen, ähnlich der Entwicklung der Formel 1.
Dabei geht es dem Italiener nicht nur um die finanziell lukrative Erschließung neuer Märkte, sondern auch um das Überleben seiner Sportart. Die Idee stieß auf gemischte Reaktionen, nicht aber wegen eines dauerhaften Wechsels auf Plastikmatten. Funktionäre nationaler Verbände wiesen darauf hin, man müsse sich in erster Linie darauf konzentrieren, die Sommersaison in etablierten Skisprungnationen weiterzuentwickeln. Mancherorts scheint die Abkehr von der schneeabhängigen Wintersaison also bereits beschlossene Sache zu sein.
Man könnte also davon ausgehen, dass der Untergang des Wintersports besiegelt sei, dass Snowboard-Hersteller langsam anfangen müssen, ihre Fabriken abzubauen, dass Skilift-Ingenieure auf Baristas umschulen und dass Eiskunstläufer lieber die Rumba als den Dreifachen Rittberger üben sollten. Tatsächlich tun wir viel dafür, dass uns ein Skigebiet nach dem anderen verloren geht. Wenn uns die Gletscher nicht schnell genug unter den Stöcken wegschmelzen, dann sprengen wir sie sogar in die Luft – so geschehen in Sölden, um die Abfahrtstrecke des Ski-Weltcups zu optimieren. Gelingt es uns nicht, den Klimawandel zu stoppen, wird es irgendwann keine Wintersport-Industrie mehr geben. Doch den steigenden Temperaturen zum Trotz wird der Untergang länger brauchen, als es nach den vorherigen Absätzen scheinen mag. Denn dem Wintersport kommt im Überlebenskampf eine vollkommen andere Entwicklung zur Hilfe – der Aufstieg der Mittelschicht in Ländern wie China oder Indien.
Mehr zur Zukunft von Sport im neuen Buch:
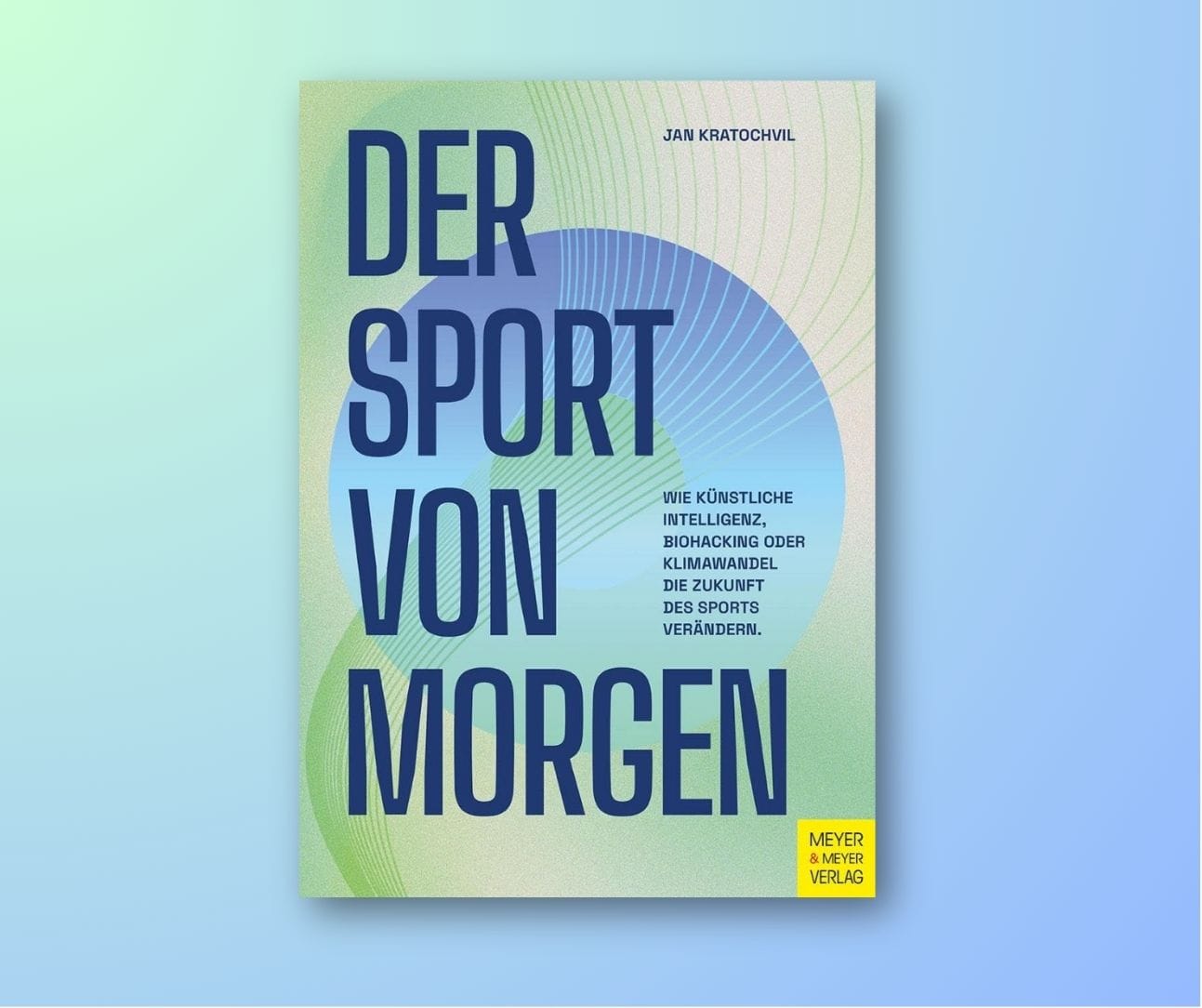
Der Sport von morgen
Neues Buch! Wie Künstliche Intelligenz, Biohacking oder Klimawandel alles verändern.


