In naher Zukunft könnten die Grenzen menschlicher Leistungsfähigkeit neu definiert werden – nicht durch Training, Talent oder Technik, sondern durch gezielte Eingriffe in unsere DNA. Verfahren wie CRISPR-Cas9 versprechen Athletinnen und Athleten, ihre körperlichen und geistigen Voraussetzungen auf molekularer Ebene zu optimieren. Was heute noch nach Science-Fiction klingt, dürfte im globalen Spitzensport binnen zwanzig Jahren zur Realität werden – mit weitreichenden Folgen für Fairness, Ethik und Chancengleichheit.
Genetische Optimierung wird für Profiathleten schon im kommenden Vierteljahrhundert einen drastischen Paradigmenwechsel bedeuten. Heute sind die biologischen Voraussetzungen unserer Körper noch per Geburt festgelegt. Unsere DNA gibt den Rahmen vor, in dem wir unsere physischen und geistigen Fähigkeiten durch Training und Lebenswandel entfalten können. In Zukunft werden wir aber die Möglichkeit haben, diese genetischen Voraussetzungen nach Belieben anzupassen. Wenn wir unseren Körper heute nur aus einem begrenzten Korb mit Lego-Steinen zusammenbauen dürfen, wird uns Genetische Optimierung morgen ermöglichen, aus einem Lego-Geschäft frei solche Steine auszuwählen, die für den Bau unseres perfekten Selbst am besten passen.
Schlüssel-Schloss-Prinzip
Im Mittelpunkt wird dabei die Genomeditierung stehen, insbesondere das CRISPR-Cas9-Verfahren. Dieses besteht aus zwei Hauptkomponenten: dem CRISPR-Teil (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) und dem Cas9-Protein (CRISPR-associated protein 9). Ursprünglich in Bakterien entdeckt, wo CRISPR als Teil des Immunsystems dient, ermöglicht diese Methode die präzise Modifikation von DNA – also der individuellen Blaupause, die zum Aufbau unseres Körpers dient. Um eine bestimmte Zielsequenz im Genom zu verändern, wird künstlich eine Guide-RNA (gRNA) erzeugt, deren Nukleotidsequenz komplementär zur gewünschten DNA-Stelle ist – sie passt also wie ein Schlüssel zum Schloss. Diese gRNA bildet mit dem Cas9-Protein einen Komplex. Sobald die gRNA die Zielsequenz auf der DNA erkannt hat – nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip –, lagert sich der Komplex dort an, und Cas9 schneidet die DNA an exakt dieser Stelle durch. Dieser Schnitt kann anschließend genutzt werden, um gezielt genetisches Material einzufügen, zu entfernen oder zu modifizieren. Auf diese Weise lassen sich spezifische Gene gezielt verändern, um bestimmte Eigenschaften zu fördern. Athletinnen und Athleten könnten Gene anpassen lassen, die für die Muskelmasse, Ausdauer oder Regenerationsfähigkeit verantwortlich sind.
Marathonläufer werden durch Genmodifikation die Produktion von EPO (Erythropoietin) regulieren, ihre rote Blutkörperchenzahl – damit die Sauerstofftransportkapazität des Blutes – erhöhen und so wiederum ihre Ausdauer erheblich verbessern. Schwimmerinnen werden Gene anpassen lassen, die die Produktion von Kollagen und anderen wichtigen Proteinen zur Gewebereparatur fördern. So wird CRISPR die Heilung von Muskeln und Sehnen unterstützen und die Regeneration nach Trainingseinheiten oder Wettkämpfen beschleunigen, wodurch wiederum ihre Häufigkeit und Intensität erhöht werden können. Fußballer werden auf die Modifikation von Genen setzen, die für Stabilität und Elastizität von Bindegewebe und Knorpeln verantwortlich sind, um so widerstandsfähiger gegen Verletzungen zu werden. Sprinterinnen oder Bodybuilder werden an Genen schneiden, die die Produktion von Myostatin drosseln (ein Protein, das das Muskelwachstum hemmt), um so größere und stärkere Muskeln aufzubauen. Für alle Athletinnen und Athleten kommt eine bessere genetische Ausstattung auch für den Umgang mit Hitzewellen oder mit weiteren, nicht-sportlichen Herausforderungen gelegen, etwa mit Krebserkrankungen oder dem Alterungsprozess als solchem.
Natürlich perfekt?
Aber leben die perfekten Athleten nicht bereits unter uns? Selbst die geschicktesten Gentechniker werden es schwer haben, einen schnelleren Sprinter zu formen als Usain Bolt oder einen besseren Schwimmer als Michael Phelps. Was oft aber übersehen wird: Die meisten „Rekordkörper“ zehren von irgendeiner Form von Abnormalität, die auch ihren Preis mit sich bringt. Bolts langgestreckter Körper hatte zwar zahlreiche biomechanische Vorteile, um die 100 Meter in 9,58 Sekunden zu laufen, der Jamaikaner leidet aber unter Skoliose, einer Wirbelsäulenverkrümmung, die unangenehme und anhaltende Schmerzen mit sich bringt.
Phelps wiederum hat seine 23 Goldmedaillen nicht nur seiner enormen Spannweite zu verdanken, sondern auch seinem extrem schnellen Stoffwechsel, der ihn in Hochleistungsphasen bis zu 12.000 Kalorien täglich verbrennen ließ – dem Äquivalent von zehn Eiern mit Käse und Brot, fünf Scheiben Speck, zehn Pancakes, einem doppelten Cheeseburger, zwei Stück Pizza mit extra Käse, einem großen Steak, drei Scheiben Knoblauchbrot, einem Ceasar Salad mit Dressing, zwei Donuts, einem Liter Cola, zwei Proteinshakes und noch ein paar weiteren Snacks. Zum Vergleich: Ein durchschnittlicher Mensch verbraucht etwa 1.500 bis 1.800 Kalorien am Tag. Ein so extremer Stoffwechsel hilft, enorme Mengen Energie umzuwandeln, ohne an Gewicht zuzunehmen. Er kann aber auch zu Nährstoffmangel, Muskelschwund im Alter, hormonellem Ungleichgewicht, kardiovaskulären Problemen oder zu einer erhöhten Anfälligkeit für Infektionen führen. Im Rampenlicht vermeintlich perfekte Körper kompensieren ihre überragenden Stärken also häufig mit unsichtbaren Schwächen. Eine entsprechend ausgerichtete Genomeditierung, würde zunächst helfen, alle „Nebenwirkungen“ abzustellen und sie bei Neuprogrammierungen gar nicht erst entstehen zu lassen.
Nun sind keinesfalls ausschließlich körperliche Eigenschaften dafür verantwortlich, wie die Karriere von Sportlerinnen und Sportlern verläuft: mentale Stärke, Spielintelligenz, Talent, der eine Geistesblitz, der nichts mit Beweglichkeit und Muskelmasse zu tun hat. CRISPR wird aber auch unsere kognitiven Fähigkeiten zu verbessern wissen. Durch die richtigen Modifikationen können Gene editiert werden, die mit der neuronalen Entwicklung und synaptischen Plastizität in Verbindung stehen, was positiven Einfluss auf unsere Lern- und Erinnerungskapazität haben wird. Durch die enorme Komplexität unseres Gehirns werden geistige und motorische Fertigkeiten aber deutlich schwerer zu beeinflussen sein als rein physische.
Letztendlich schließt das eine das andere aber auch nicht aus. Eine talentierte, hochgewachsene Volleyballerin wird immer bessere Chancen auf den perfekten Schlag haben als eine talentierte, kleine. Und obwohl heterogene Teams bei kreativer Problemlösung nachweisliche Vorteile gegenüber homogenen Teams haben, gibt es schon heute Entwicklungen, die auch ohne genetische Optimierung zu einer Angleichung von Spitzenathletinnen und -athleten führen. Die Streuung der Körpergröße im Fußball hat beispielsweise massiv abgenommen, wobei Torhüter immer größer werden. So lag beispielsweise in der Saison 2022/2023 die Durchschnittsgröße der in der Bundesliga zum Einsatz gekommenen Torhüter bei 191 cm, während 1972/1973 der durchschnittliche Bundesliga-Torwart noch 182 cm groß war – einer der Gründe, weshalb Italiens Ex-Nationaltorwart Gianluigi Buffon eine Vergrößerung der Tore fordert.
Eine Frage der Balance
Erfolgreiche Athletinnen und Athleten in Sportarten, die verschiedene Fähigkeiten kombinieren, zehren in der Regel aber nicht von der einen besonderen Stärke, sondern von einer Harmonie diverser Eigenschaften. Schwächen werden von Stärken kompensiert, und am Ende entsteht … Lionel Messi. Hätte eine hypothetische Genetik-Abteilung den Scouts des FC Barcelona nicht versucht auszureden, diesen viel zu kleinen argentinischen Floh in ihre Nachwuchsakademie aufzunehmen? Oder noch schlimmer, hätte man nicht versucht, Einfluss auf Messis Eltern zu nehmen, das Wachstum ihres Sohnes zu beschleunigen? Vielleicht hätte man damit seinen Schwerpunkt unglücklich verlagert, seine Motorik aus der Balance gebracht. Oder aber Messi wäre noch dominanter geworden. Vielleicht hätten die Genetik-Abteilungen von Real Madrid, Manchester City und FC Bayern aber auch Verteidiger heranwachsen lassen, an denen jener Messi, den wir heute kennen, nicht mehr ohne eigene Optimierungen vorbeigedribbelt wäre.
Was heute alles noch nach gefährlichen Frankenstein-Spielchen klingt, wird in recht naher Zukunft eine gängige medizinische Praxis sein, die die Menschheit von Erkrankungen wie Sichelzellenanämie, Muskeldystrophie oder sogar Krebs befreien kann. Mit der fortschreitenden Sequenzierung des menschlichen Genoms werden wir unsere individuellen genetischen Profile bis ins kleinste Detail kennen. Wir werden außerdem genau wissen, welche Anpassung zu welchem Resultat führt. Bei Off-Target-Effekten schneidet CRISPR heute noch unbeabsichtigt auch mal an nicht zielgerichteten Stellen, was zu unerwünschten Mutationen führen kann. Spätestens 2050 wird dieses Problem durch eine perfekte Kenntnis unseres „Bauplans“ gelöst sein. Sie wird dann auch eine an unseren Körperbau maßgeschneiderte Gestaltung von Trainingsplänen und Ernährungsstrategien ermöglichen.
Im Übrigen ist es absehbar, dass Verfahren zur genetischen Optimierung vor der Geburt effizienter funktionieren werden als danach. Sobald es technisch möglich ist, werden deshalb viele Eltern auf CRISPR zurückgreifen, um Krankheiten ihres Ungeborenen zu verhindern. Der Übergang von nachvollziehbaren Maßnahmen zu Korrekturen, die ausschließlich kosmetische oder athletische Eigenschaften anpassen, wird dann fließend sein. Vermutlich werden viele Länder derartige Modifikationen aus ethischen Gründen verbieten oder zumindest herauszögern. Doch was, wenn in anderen Ländern genetische Optimierung zum Standard wird, um die Karrierechancen des Kindes – und damit der gesamten Bevölkerung – auf dem globalen Markt zu verbessern, auch und insbesondere im Sport? Wäre es den Eltern dann nicht sogar moralisch geboten, ihrem Kind dieselben Chancen wortwörtlich in die Wiege zu legen?
Shifting Baselines
Es ist wahrscheinlich, dass Vereine und Ausbildungszentren eines Tages Athletinnen und Athleten bevorzugen werden, deren körperliche sowie geistige Prädisposition genetisch analysiert, wenn nicht sogar optimiert wurde, um ein schlaksiger, aber trotzdem muskulöser Sprinter oder eine langatmige und leichte Marathonläuferin werden zu können. Wenn wir in einer solchen Welt nicht leben wollen: Wie gelingt es uns, einen Konsens zu finden, nach dem sich die globale Sportgemeinde einheitlich richten wird? Vielleicht wird uns dann die Vorstellung einer Trennung in regulierte und unregulierte Wettbewerbe gar nicht mehr so abwegig vorkommen.
„Shifting Baselines“ nennt sich das Phänomen, bei dem sich die subjektive Bewertung dessen, was noch angemessen ist und was bereits zu weit führt, schrittweise verschiebt – angetrieben von gesellschaftlichen Entwicklungen, Gewöhnung, aber auch von purem Kommerz. Denn Veranstalter, Sponsoren oder Medienrechteinhaber werden sich fragen, ob die Fans sich lieber einen Sprinter ansehen, der die 100 Meter in knapp zehn Sekunden läuft, oder einen, der mit einem „enhanced“ Weltrekord als erster spektakulär die neun Sekunden unterbietet.
Noch sind Gen- und Zelldoping im Sport allgemein verboten. Doch der ethische Umgang mit genetischer Optimierung wird aus mehreren Gründen schwieriger ausfallen als heute bei konventionellem Doping. Erstens werden viele Behandlungen auch in der breiten Öffentlichkeit akzeptiert und verbreitet sein – teils aus kosmetischen, aber überwiegend aus gesundheitlichen Gründen. Zweitens spielt beim Dopingverbot die körperliche Unversehrtheit eine zentrale Rolle – genetische Optimierung wird jedoch ab einer bestimmten Entwicklungsstufe praktisch risikofrei sein. Drittens werden solche Maßnahmen kaum nachweisbar und dadurch nicht sanktionierbar sein, was viertens insbesondere solche Verbände oder Länder, die schon heute kulant mit Doping umgehen, dazu verleiten wird, den Geist der Genomeditierung früher aus der Flasche zu lassen, als der Konkurrenz lieb sein wird. Vielleicht haben sie es bereits getan.
Es ist wichtig zu begreifen, dass die genetische Optimierung auch heute nicht isoliert Verwendung findet, sondern in Wechselwirkung mit anderen fortschrittlichen Technologien angewandt wird. Stammzellenforschung beispielsweise kann das Potenzial von genetischer Optimierung erheblich erweitern, da genetisch modifizierte Stammzellen als Vektoren für eine wirkungsvollere Gen-Therapie dienen können. Beschädigte Organe und Gewebe können so besser regenerieren oder sogar komplett neu gezüchtet werden. Die Möglichkeiten wären nicht nur die Heilung von bislang Unheilbarem, sondern im Äußersten auch die kontinuierliche Verjüngung unserer Körper. Unverzichtbar werden auch Innovationen wie künstliche Intelligenz und Quantencomputing sein, die die Verarbeitung und Auswertung der benötigten Datenmengen überhaupt erst möglich machen. Nanotechnologie wird wiederum eine immer präzisere und risikoärmere Ausführung der Genomeditierung sicherstellen.
Mehr im neuen Buch zur Zukunft des Sports:
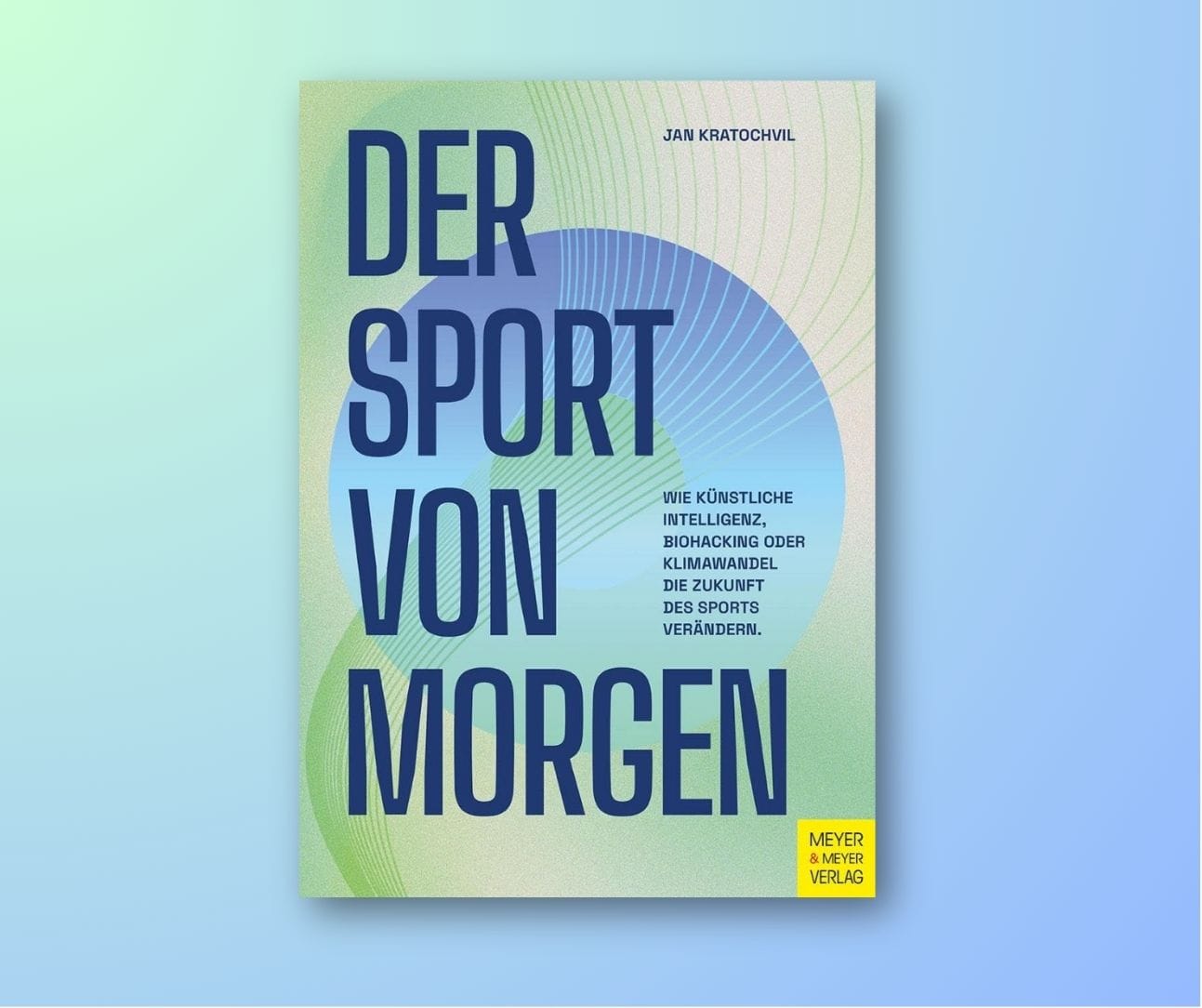
Der Sport von morgen
Neues Buch! Wie Künstliche Intelligenz, Biohacking oder Klimawandel alles verändern.


