Wie technologische Innovationen die Herstellung von Laufschuhen revolutioniert haben – und warum wir in zwanzig Jahren maßgeschneiderte Modelle selbst zu Hause drucken werden. Eine Reise von der Ledersandale bis zum Replikator.
Zweifelsohne können innovative Sportartikel einen erheblichen Wettbewerbsvorteil mit sich bringen. Nehmen wir als Beispiel ein heute besonders verbreitetes Produkt: Laufschuhe. Schätzungen gehen jährlich von mindestens 200 Millionen produzierten Paar echter Spezialschuhe aus, ein 20-Milliarden-USD-schwerer Markt, krisenfest und wachstumsstark. Laufen liegt im Trend, nicht erst seit COVID.
Bei den ersten Olympischen Spielen der Antike trugen Sportler noch bestenfalls Sandalen mit Knöchelriemen an den Füßen, im Mittelalter musste man sich mit robusten Lederschuhen zufriedengeben. Erst Ende des 19. Jahrhunderts begannen sich die Dinge zu ändern: 1895 stellte das britische Unternehmen J. W. Foster die ersten Spikes her und rüstete damit zahlreiche zukünftige Olympiasieger aus. Zwei Generationen später würde J. W. Fosters Enkel das Unternehmen umbenennen, in den besser klingenden Namen Reebok.
Carbon oder nichts
Die Popularisierung des Laufsports als Freizeitbeschäftigung insbesondere in den USA förderte auch die technische Weiterentwicklung von Schuhen. In den 1970er-Jahren verpasste Bill Bowerman den Gummisohlen seiner Laufschuhe mit einem Waffeleisen ein rutschfestes Profil. Gemeinsam mit seinem Zögling Phil Knight nannten übrigens auch sie ihre Marke um, von Blue Ribbon Sports in Nike. Einen großen Einfluss auf die Beschaffenheit, Funktionalität und Herstellung hatte die Entwicklung neuer Kunststoffe. Schuh-Upper aus leichten Polyesterfasern statt Leder oder gedämpfte Mittelsohlen aus geschäumten Elastomeren statt Kautschuk ließen jene Laufschuh-Typen entstehen, die wir heute kennen.
In den Folgejahren unterlagen auch sie unterschiedlichen Trends, meist geprägt von neuen Hypothesen aus der Biomechanik oder Orthopädie: Mal klobig stabil, dann wieder minimal, eher naturalistisch, heute leicht, je nach Streckenlänge eher stark gedämpft.
Die letzte wesentliche Innovation war die Entwicklung einer in der Schuh-Mittelsohle eingelassenen Carbonplatte im Jahr 2016. Sie sollte Läuferinnen und Läufern helfen, die Energieeffizienz zu steigern, indem sie die Vorwärtsbewegung unterstützt, die Stabilität erhöht und das Abrollen beschleunigt. Nike hatte einen solchen Schuh als erstes auf den Markt gebracht und mit dem Versprechen beworben, er könne Athleten vier Prozent schneller machen. Tatsächlich bestätigte sich der Vorteil, woraufhin Nikes Carbon-Laufschuhe zwischenzeitlich für offizielle Rennen verboten und dadurch noch beliebter wurden. Um keinen Nachteil im Wettbewerb zu haben, verließen viele Topathleten sogar ihre Ausrüster und liefen freiwillig und umsonst mit Nikes Spitzenmodell los. Kurz darauf legte die Konkurrenz um Adidas & Co. mit eigenen Carbon-Modellen nach. Heute gehören sie zum festen Repertoire jeder größeren Laufmarke.
Community statt Innovation?
Immer leichter, immer schneller, immer bequemer sollen Laufschuhe heute sein. Manche Hersteller versuchen, weitere Argumente ins Spiel zu bringen: Die Marken Altra und Joe Nimble stellen besonders breite Laufschuhe her, damit sich Füße gesünder ausbreiten können. Vivobarefoot und Xero setzen auf minimale Dämpfung, um ein natürlicheres Laufgefühl zu bieten. Marken wie Icebug, Hylo oder Winqs stellten wiederum Schuhe mit umweltschonenderen Materialien und Herstellungsprozessen vor.
Der globale Aufschwung des Laufsports hat nicht nur dazu geführt, dass bestehende Laufmarken gezwungen sind, immer neue (mal mehr, mal weniger wirksame) Technologien präsentieren zu müssen. Außerdem erlebt die Industrie einen Boom an neuen, hochpreisigen Szenemarken wie Bandit, Norda oder Satisfy, die eine stilsichere Brücke zwischen Performance und nischiger Mode schlagen. Mittels weltweit verteilter Laufgruppen aus Fans dieser Marken bilden sich so Communities, von deren Markentreue Unternehmen wie Adidas oder Nike nur träumen können. Laufschuhe sind so nicht nur zu einem hoch-technologischen Produkt, sondern gleichzeitig auch zu einem ernsthaften Fashionstatement geworden.
Selbst die einfachsten Modelle werden mittlerweile aus weit über 30 Einzelteilen gefertigt, hergestellt mit bis zu zehn unterschiedlichen Materialien. Ein aufwendiger, nicht besonders umweltschonender Prozess: Atmungsaktive Upper werden mit Flachstrickmaschinen aus Polyester-Garn hergestellt, Laminiermaschinen verbinden sie mit stabilisierenden TPU-Schichten, und Laserschneidemaschinen sorgen für präzise Zuschnitte. Ultraleichte Schaumstoffe werden per Spritzgussverfahren in Mittelsohlen geformt und mit Torsionssystemen für stabilisierende Mittelfußbrücken verklebt, Außensohlen aus synthetischem Gummi werden in Kompressionsformen eingelegt und vulkanisiert … und nach vielen weiteren Schritten wird ein Schuh daraus.
Viele Konzepte, wenig Wandel
Wie es technologisch weitergehen kann, deuten verschiedene Konzeptprojekte an. 2016 stellte Adidas mit seiner Speedfactory eine teilautomatisierte Produktionsstätte vor, 2019 präsentierte man den Laufschuh Futurecraft.Loop, der aus einem einzigen Material bestand und deshalb vollständig recycelbar sein sollte. On Running kündigte 2023 an, Schuhe aus Abgasen herstellen zu wollen. Durch ein spezielles Verfahren könne man CO2-Emissionen per Fermentation in flüssiges Ethanol umwandeln, aus dem dann EVA-Schaumstoff und schließlich eine Schuhmittelsohle namens CleanCloud hergestellt werden könne. 2024 legten die Schweizer nach und präsentierten die LightSpray-Technologie – ein Verfahren, bei dem der Schuhmantel nicht genäht, sondern gesprüht wird. Dadurch würden nicht nur Abfälle und bis zu 75 Prozent der üblichen Schadstoffemissionen vermieden, sondern der Schuh wäre zudem leichter und bequemer.
2025 soll wiederum Nike ein Patent für ein innovatives Schuhsystem eingereicht haben, das sogenannte „Active Fluid Control Systems“ beinhaltet. Sie sollen den Halt und die Dämpfung des Schuhs durch in Echtzeit steuerbare Flüssigkeitsbewegungen im gesamten Schuhkörper anpassen. Das 133-seitige Dokument beschreibt unter anderem Ventile, Pumpen, Drucksensoren, Fluidkammern sowie elektronische Bedienelemente und Kommunikationsfunktionen. Ziel soll sein, den Tragekomfort und die Unterstützung dynamisch an unterschiedliche Laufbedingungen und Ermüdungszustände anzupassen. Ob es sich wirklich um bahnbrechende Technologien handelt oder Nike nur einen neuen Innovationstrieb antäuscht, wird sich in den kommenden Jahren zeigen.
Denn was all diese beeindruckenden und vor allem marketingtauglichen Konzepte gemein haben: Bislang hat scheinbar keines von ihnen die Art und Weise verändert, wie die große Mehrheit der Laufschuhe hergestellt und entsorgt wird. Im Wesentlichen laufen wir immer noch in einem verklebten Klumpen unterschiedlicher Plastikteile durch die Gegend. Zwar macht er uns jedes Mal eigenen Sekundenbruchteil schneller, dafür halten moderne Laufschuhe immer kürzer und enden dann meist in Verbrennungsanlagen oder auf überfüllten Müllhalden in Ostafrika.
Drei Revolutionen
Es ist aber absehbar, dass wir in den kommenden Jahrzehnten einige revolutionäre Entwicklungen erleben werden – nicht nur, weil sie technisch möglich sein werden, sondern weil strengere ökologische Vorgaben und der dringende Bedarf an sichereren Lieferketten sie erforderlich machen. Dabei werden drei Bereiche Veränderungen mit sich bringen, die sich auch auf andere Sportartikel übertragen lassen, auf Tennissocken etwa oder auf Skibrillen.
Künstliche Intelligenz wird uns mit neuen Rezepturen helfen, perfekt optimierte Materialien zu entwickeln. Dabei wird es nicht nur um Gewicht oder Atmungsfähigkeit gehen. Supramolekulare Polymere (lose Kunststoff-Strukturen) werden die Langlebigkeit von Laufschuhen massiv verbessern. Schwache, reversible Wasserstoffbindungen werden es ermöglichen, anpassbare sowie selbstreparierende Stoffe herzustellen, die sich bei Belastung lösen, wieder verbinden und so selbst heilen.
Andere Materialien werden Mechanismen aus der Natur nachahmen können, bei denen zirkulierende Flüssigkeiten oder Nanopartikel Schäden erkennen und reparieren. Auch werden neue Stoffe auf magnetische oder elektrische Felder reagieren, was es ermöglicht, mit einfachen Magneten Moleküle neu zu ordnen und so etwa Sohlen zu reparieren. Formbare, graphenbasierte Polymere, die leicht, aber praktisch unzerstörbar sind, werden unsere Laufschuhe extrem widerstandsfähig machen können – sofern es die Hersteller zulassen.
Wir werden lernen, noch umfassender erdölbasierte durch biobasierte, nicht toxische Kunststoffe zu ersetzen, etwa aus Mais- oder Zuckerrohrabfällen. Molekulares Recycling, das bei Textilien schon heute angewandt werden kann, wird jeden Schuh am Ende seines Lebens in seine molekularen Einzelteile zerlegen und wiederverwerten lassen. Spezielle Enzyme werden es ermöglichen, selbst die robustesten Stoffe kompostierbar zu „programmieren“, sobald sie nicht mehr für ihren ursprünglichen Zweck verwendet werden. Auf diese Weise werden wir auch das enorme Müllproblem der Industrie angehen können, die heute allein mit Laufschuhen jährlich etwa 80.000 Tonnen Kunststoffmüll hinterlässt und Wasser, Erde und Luft mit Mikroplastik verschmutzt.
Neue Materialien werden aber nicht nur langlebiger, leichter oder umweltfreundlicher sein, ihre Formbarkeit wird es außerdem ermöglichen, Laufschuhe bis ins letzte Detail zu personalisieren. Dabei sind keineswegs wie heute nur Farbvarianten und gestanzte Initialen gemeint. Basierend auf präzisen Körperscans werden wir in der Lage sein, umfassende biometrische Angaben in entsprechenden Datenbanken abzulegen und sie in verwertbare technische Anweisungen zu übersetzen. Nicht nur wird unsere Fußform präzise vermessen, unser Datenprofil wird auch Parameter wie Motorik, Laufstil, bevorzugte Streckenarten, Verletzungen oder sogar unsere Knochendichte beinhalten.
In der anschließenden Produktion werden dann neben der idealen Größe auch die Dämpfung, die Form des Fußbetts, die Schuhsprengung sowie alle Stabilisierungselemente angepasst. Dabei wird uns auch der medizinische Fortschritt zugutekommen, der stetig bessere Anweisungen liefern wird, wie wir mit Verletzungen oder Fehlstellungen umgehen sollten.
Natürlich sind derartige Maßanfertigungen heute noch technisch unmöglich und wären auch unerschwinglich. Es gibt aber bereits Lösungen, die zumindest unsere Laufeigenschaften präzise vermessen: Einlegesohlen des niederländischen Unternehmens Arion analysieren beispielsweise, wie unser Fuß beim Laufen auftritt, und helfen so, die Lauftechnik zu verbessern oder die richtigen Schuhe zu finden. Das schwedische Unternehmen Qualisis ermöglicht es, mithilfe eines Motion-Capture-Verfahrens die Laufmotorik von Läuferinnen und Läufern zu vermessen, sie mit den optimalen Bewegungsachsen von Profiläufern zu vergleichen und so Verbesserungsvorschläge für einen effizienteren und gesünderen Lauf zu machen. Doch selbst wenn uns alle Daten zur Verfügung stünden, um unseren perfekten Laufschuh entwerfen zu können, ließe sich dieser über konventionelle, auf Massenproduktion ausgelegte Fertigungsstraßen nicht herstellen. Doch auch dieser Prozess wird sich ändern.
Laufmarken werden darauf hinarbeiten, ihre gesamte Lieferkette nach und nach zu verkürzen, bis sie eines Tages in einem einzigen 3D-Druck-ähnlichen Fertigungsprozess gebündelt wird. Diese Vereinfachung der Produktion wird es ermöglichen, Laufschuhe dezentral herzustellen – außerhalb von Fabriken, etwa bei Marathonläufen, in Sportgeschäften oder irgendwann auch bei jedem von uns zu Hause. Der US-amerikanische Futurologe Michio Kaku beschrieb in seinem Buch Die Physik der Zukunft einen Replikator, in Anlehnung an das gleichnamige Gerät aus der Science-Fiction-Serie Star Trek.
Wie eine magische Mikrowelle wird dieses Gerät in einer Ecke unserer Wohnung kleine Wunder vollbringen. Anstatt in Geschäften physische Ware zu kaufen, werden wir in absehbarer Zukunft lediglich eine Produktlizenz erwerben. Mit einem entsprechenden Bauplan-Code und dem Herstellungsauftrag versorgt, legt der Replikator los: Mit speziellen Materialkartuschen (ähnlich wie Tintenpatronen bei heutigen Druckern), die etwa Biopolymere oder Graphen beinhalten, und präziser Nanotechnologie werden einzelne Moleküle Koordinate für Koordinate zu unserem neuen Laufschuh angeordnet – auf den Nanometer genau, personalisiert nach unserem biometrischen Profil und unseren Wunschanpassungen.
Im Übrigen gibt es keinen Grund, warum ein solcher Replikator, wenn mit den richtigen Kartuschen versorgt, nicht auch jeden anderen Gegenstand produzieren könnte – von den erwähnten Tennissocken über Lavalampen bis hin zu Nudelgerichten oder sogar Körperteilen. Ein solches Verfahren wird nicht nur unsere eigenen Besorgungen vereinfachen. Es wird außerdem den bestehenden Welthandel erschüttern, der auf internationalen Lieferketten basiert. Schritt für Schritt werden Fabriken und ihre Zulieferer Aufträge an lokale Fertigungsstätten verlieren. Statt in China oder Vietnam werden Schuhe immer näher am Endkunden hergestellt – in spezialisierten Laufgeschäften oder regionalen Fertigungsstätten der Marken.
Nicht nur Läuferinnen und Läufer, sondern auch der Sporthandel wird von dieser Entwicklung zunächst profitieren: geringere Produktions- und Lagerrisiken, günstigere Herstellungs- und Logistikkosten, kürzere Lieferzeiten. Sobald sich Replikatoren jedoch zu alltäglichen Haushaltsgeräten entwickeln, wird auch dieser Teil der Lieferkette entfallen. Übrig bleiben werden Laufmarken, deren Designer und Ingenieure neue Modelle codieren oder von KI codieren lassen (und von einem Tag auf den anderen updaten), sowie Läuferinnen und Läufer, die sich ihre Laufschuhe online aussuchen, herunterladen und zu Hause drucken lassen.
Fortschritt braucht Geduld
Wann uns eine magische Mikrowelle unseren maßgeschneiderten, unzerstörbaren, kompostierbaren Laufschuh zubereiten wird? Man könnte denken, dass all diese Innovationen schon um die Ecke auf uns warten. Tatsächlich sind wir bereits heute imstande, Moleküle durch 3D-Drucktechnologien oder molekulare Maschinen (Nanomaschinen) herzustellen und zu manipulieren: Peptid-Synthesizer, die Sequenzen von Aminosäuren drucken, biotechnologische Verfahren wie die DNA-Origami-Technologie, die DNA-Abschnitte für genetische Forschung oder die Herstellung von Proteinen flechten. Die Präzision eines solchen „Moleküldrucks“ reicht aber noch bei Weitem nicht aus. Insbesondere größere und komplexe Moleküle sind äußerst schwer herzustellen. Auch ist der Prozess noch sehr teuer und meist nur für Forschungseinrichtungen zugänglich. Hinzu kommt, dass der Entwicklungszustand heutiger Kunststoffe wie Polyester oder EVA und anderer Materialien erst recht primitiv ist; auch die Herstellung „universeller“ Kartuschen wird noch einiges an Zeit benötigen. Doch der technologische Fortschritt beschleunigt sich exponentiell.
Hinzu könnte eine Künstliche Allgemeine Intelligenz (siehe auch dazugehöriges Kapitel) von einem Tag auf den anderen sämtliche Blaupausen für neue Materialien, Körperscans und Replikatoren liefern. Gehen wir von Expertenschätzungen aus, wann welches der beschriebenen Probleme gelöst sein dürfte, werden wir vermutlich bis 2030 die ersten vollautomatisierten Laufschuh-Produktionen erleben, bis 2040 die ersten gänzlich individualisierten Laufschuh-Paare und bis 2050 die ersten Replikatoren, die zunächst einfache und später immer komplexere Konsumgüter herstellen werden. Allen technologischen Entwicklungen zum Trotz, in unseren neuen Schuhen laufen dürfen wir dann aber immer noch selbst.
Mehr als nur Laufschuhe
Wie erwähnt, sind futuristische Laufschuhe nur ein Beispiel für das Potenzial, das uns kommende Technologien erschließen lassen werden. Die Vorboten sehen wir schon heute überall, etwa bei der Entwicklung von Helmen. Zur Tour de France 2024 präsentierte Radstar Jonas Vingegaard einen extravagant ausgeformten Zeitfahr-, also eine Art Sprinterhelm. Entwickelt in Zusammenarbeit mit seinem Team, zeichnet er sich durch ein kurioses Design aus, das Kopf, Unterarme und Lenker aerodynamisch vereint, um die Luftströmung zu optimieren und den Luftwiderstand zu minimieren. Der Helm wurde in Windkanaltests und bei Etappenrennen erprobt und verhalf Vingegaard (neben viel Spott seitens seiner Konkurrenten) zumindest zum zweiten Platz hinter Toursieger Pogačar.
Das britische Unternehmen Rheon will wiederum ein gleichnamiges energieabsorbierendes Superpolymer entwickelt haben, das in seinem natürlichen Zustand weich und flexibel ist, aber beim Aufprall verhärtet, um deutlich mehr Energie absorbiert als herkömmliche Materialien. Es wird bereits in modernen American-Football-Helmen genutzt, um Impulskräfte zu reduzieren und den Schutz bei Kollisionen zu erhöhen. Rheon kann aber auch in anderen Sportarten verwendet werden, etwa in Laufbekleidung, Motorradschutzkleidung und Padel-Schlägern, wo es zur Reduzierung von Muskelermüdung oder zu geringeren Vibrationen beiträgt.
Mehr zur Zukunft von Sport im neuen Buch:
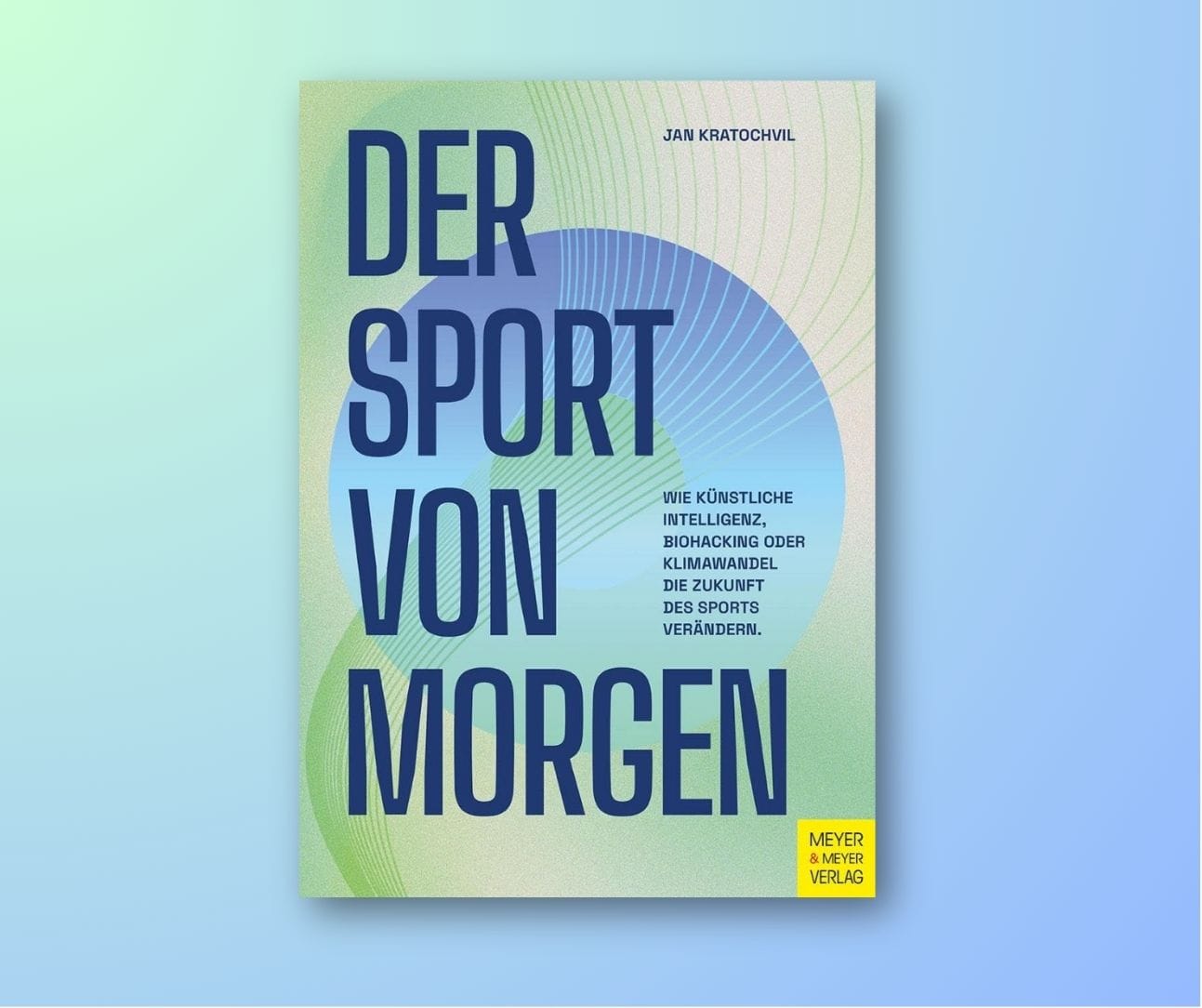
Der Sport von morgen
Neues Buch! Wie Künstliche Intelligenz, Biohacking oder Klimawandel alles verändern.


