Noch erfordert der Abschluss der Vereinbarung grünes Licht der Regulierungsbehörden. Der kartellrechtliche Prüfprozess des US-Justizministeriums kann bis zu zwölf Monate dauern. Und schon hier kommt der unabhängige Sportjournalismus zum ersten Mal ins Straucheln. Donald Trump hat die einflussreiche Bundesbehörde mit Vertrauten besetzt, was zuletzt erhebliche Auswirkungen auf die Fusion der Medienhäuser Paramount und Skydance hatte. Einen 16 Millionen USD hohen Vergleich mit Trump und eine Kündigung von Late-Night-Talker Stephen Colbert später wurde das Geschäft durchgewunken.
Auch NFL und ESPN werden aufs Wohlwollen im Weißen Haus angewiesen sein, um die Freigabe nicht zu gefährden. Beispielsweise drohte Trump zuletzt öffentlich, den Bau eines neuen NFL-Stadions in Washington D.C. zu blockieren, falls das Team Washington Commanders den 2020 eingeführten neuen Namen nicht wieder in „Redskins“ rückbenennt. Dass ESPN über ein solches Thema in Zukunft kritisch und unabhängig berichtet, wird nun immer unwahrscheinlicher.
Das Entertainment and Sports Programming Network, bislang zu 80 % im Eigentum von Disney, ist seit Jahrzehnten der dominierende Sport-TV-Anbieter in den USA. Gestartet 1979 hat sich die Organisation von einem reinen Kabelkanal zu einem multimedialen Imperium mit TV-, Online- und Streaming-Angeboten entwickelt. Über sein Pay-TV-Bündel erreicht ESPN bis zu 75 Mio. US-Haushalte. Zusätzlich abonnieren etwa 25 Mio. Nutzer den Streamingdienst ESPN+ , der seit 2018 verfügbar ist.
Dennoch hatte das Unternehmen mit der digitalen Disruption des Marktes zu kämpfen. Sinkende Kabel-TV-Abonnements zwangen ESPN, sich neu aufzustellen. Disney-CEO Bob Iger verfolgt die Strategie, ESPN stärker direkt an Endkunden zu bringen. Noch im Herbst 2025 soll ein eigenständiges ESPN-Streaming-Netzwerk starten.
Der NFL-Deal passt also genau in diesen Kurs. ESPN erhält das Recht, die digitalen Kanäle NFL Network und RedZone sowohl im klassischen Kabel als auch auf der neuen Plattform zu verbreiten. Durch die Verschmelzung der Fantasy-Football-Plattformen von NFL und ESPN verspricht man sich zusätzliche Nutzerbindung in der digitalen Welt. Alleine 2024 generierte die NFL beeindruckende 11 Milliarden USD aus Medienrechten. Der Gegenwert der Anteile von 2,5 Milliarden USD erscheint somit mehr als günstig (ESPN wird aktuell auf 25 Milliarden USD geschätzt).
Nun gelten Rechteträger gegenüber ihren Rechtegebern in ihrer Berichterstattung so schon als zurückhaltend. Schließlich will man weder zukünftige Vergaben gefährden, noch das Produkt schädigen, das man teuer erstanden hat. Auch galt ESPN nie als besonders investigativ oder kritisch. Der geschlossene Deal dürfte diese Tendenz aber in Blei gießen.
Dabei hatte gerade die NFL, mehr als jede andere US-Profiliga, in den vergangenen Jahren mit schlechter Presse zu kämpfen - allen voran der Streit um die Hirnkrankheit CTE (chronische traumatische Enzephalopathie), ausgelöst durch wiederholte Kopftraumata, wobei die Liga jahrelang die Risiken heruntergespielt und vertuscht haben soll. 2013 folgte ein Vergleich über hunderte Millionen Dollar für betroffene Ex-Spieler. Daneben sorgten Affären wie Bountygate (Prämien für das Verletzen von Gegnern), Deflategate (manipulierte Spielbälle), Gewalt- und Missbrauchsfälle sowie die Kontroverse um Colin Kaepernicks Proteste gegen Polizeigewalt für Schlagzeilen.
Doch obwohl ESPN mit diesem Deal auch die letzte journalistische Durchschlagskraft verloren gehen wird, ist absehbar, dass seine Dominanz in der nordamerikanischen Medienlandschaft zunehmen wird. Denn während traditionelle, dem unabhängigen Journalismus verpflichtete Titel ihre Sportredaktionen abbauen - die prestigeträchtige New York Times übernahm das Portal The Athletic und schloss 2023 die ihre sogar gänzlich - dürfte ESPN mit den Medienrechten der wertvollsten Liga des Kontinents und den damit verbundenen Ressourcen nur an Gewicht gewinnen.
Hinzu kommen „günstige“ Synergien. Es ist absehbar, dass bei der NFL jene Werbetreibende besonders wohl gelitten sein werden, die sich auch mit ESPN gut verstehen. Ein weiterer Vorteil, insbesondere im Wettbewerb mit von Werbeeinnahmen abhängigen Medienhäusern. Sollten diese auf die wahnwitzige Idee kommen, trotzdem um NFL-Rechte bieten zu wollen, könnten sich diese in noch unerschwinglichere Höhen hochschrauben. Dort dürften sie auf die steigenden Abo-Preise treffen. Denn ist die potenzielle Konkurrenz erstmal kaltgestellt, hätte ESPN auch hier deutlich mehr Freiheiten.
Ähnliche Muster lassen sich zunehmend auch in Europa feststellen, sogar in Deutschland. Der Einstieg des saudi-arabischen Staatsfonds im Streamingdienst DAZN (PIF erwarb Anteile für eine Millarde EUR) erfolgte vorm Hintergrund der Vergabe der Fußball-WM an Saudi Arabien. Gleichzeitig erwarb DAZN von der FIFA die Übertragungsrechte an der Klub-WM - für ziemlich genau eine Milliarde EUR. Von kritischer Berichterstattung zu leeren Sportstätten oder anderweitigen Problemen des Wettbewerbs hörte man danach wenig.
Einen anderen Grund dürfte der Einstieg der Deutschen Fußball-Liga (DFL) in den jungen Streamingdienst DYN haben (Anteil etwa 6,5 %). Die DFL wünscht sich seit Längerem eine eigene Video-Plattform, um den internationalen und später vielleicht auch nationalen Markt direkt zu versorgen. Die Koppelung an DYN könnte teilweise den geplatzten Investorendeal ersetzen, der das notwendige Kapital für eine eigene OTT-Plattform liefern sollte. Auch bei DYN entsteht so aber eine Blutsverwandschaft, die jegliche Neutralität aushebelt - wenn nicht per Direktive, dann vielleicht per gut gemeinter Selbstzensur.
Nun handelt es sich bei DAZN und DYN um neue Medien des Streaming-Zeitalters, deren redaktionelles Programm nur wenige bis gar keine investigative Formate vorsieht - und diesen fehlenden Anspruch auch gar nicht versucht zu kaschieren. Indem sie aber immer größere Anteile des Rechtemarktes für sich beanspruchen, schrumpft die Bedeutung unabhängiger Alternativen. Man sieht so nur noch deutlicher den Wert öffentlich-rechtlicher Medienanstalten, die trotz Rechteinhaberschaft, problematische Umstände rund um Großveranstaltungen wie Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften aktiv hinterfragen.
Wer aber schlägt Alarm? Die gemeinnützige Organisation Public Knowledge etwa warnte jüngst vor Konzentrationstendenzen im Sportstreaming-Markt und sogar der US-Senat befasste sich in Anhörungen mit steigenden Kosten und fehlendem Wettbewerb. In Deutschland dürften Organisationen wie der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) oder andere Medienwächter vergleichbare Bedenken anmelden, wenn Verbände wie die DFL in Medienunternehmen einsteigen. Noch sind die hiesigen Stimmen aber leise.
Die historisch gewachsene Trennung zwischen Sportveranstalter und Sportjournalist wird also immer weiter aufgehoben. Sollten die beschriebenen Allianzen für alle Beteiligten erfolgreich sein, könnte ein internationaler Nachahmeffekt einsetzen. Für Sportfans mag das auf den ersten Blick mehr Inhalte „aus einer Hand“ bedeuten. Langfristig droht jedoch ein Ökosystem, in dem kritische Nachfragen verstummen, unbequeme Geschichten unerzählt bleiben und journalistische Stimmen hinter kommerziellen Interessen zurücktreten. Es liegt an den verbleibenden unabhängigen Medien und Institutionen, dieser Entwicklung etwas entgegenzusetzen – und die Fackel des kritischen Sportjournalismus hochzuhalten, bevor sie erlischt.
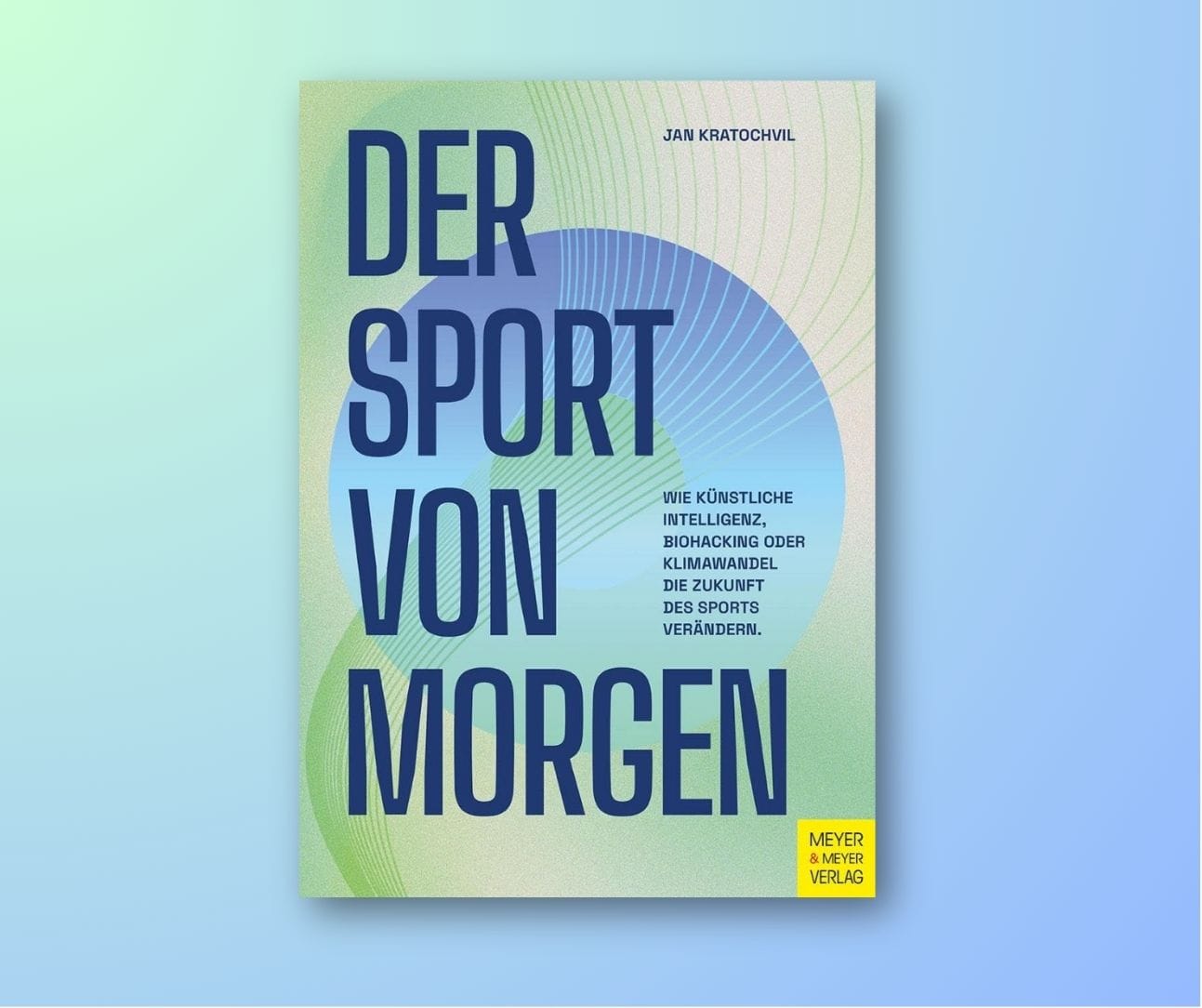
Der Sport von morgen
Neues Buch! Wie Künstliche Intelligenz, Biohacking oder Klimawandel alles verändern.


